Schumanns
Lebensweg 1810-1841
 Am
8. Juni 1810 wird Robert Schumann als jüngstes von fünf Geschwistern
in Zwickau geboren. Sein Vater ist Buchhändler, Verleger und Buchautor.
Mit sechs oder sieben Jahren erhält er seinen ersten Klavierunterricht
beim Stadtorganisten Kuntsch, dem er zeitlebens freundschaftlich verbunden
bleibt. Schon früh organisierte er eigene Aufführungen mit Instrumentalisten,
die gerade zur Verfügung standen, dirigierte und ergänzte die
fehlenden Stimmen am Klavier. Mit zwölf Jahren schreibt er seine erste
Komposition,
Am
8. Juni 1810 wird Robert Schumann als jüngstes von fünf Geschwistern
in Zwickau geboren. Sein Vater ist Buchhändler, Verleger und Buchautor.
Mit sechs oder sieben Jahren erhält er seinen ersten Klavierunterricht
beim Stadtorganisten Kuntsch, dem er zeitlebens freundschaftlich verbunden
bleibt. Schon früh organisierte er eigene Aufführungen mit Instrumentalisten,
die gerade zur Verfügung standen, dirigierte und ergänzte die
fehlenden Stimmen am Klavier. Mit zwölf Jahren schreibt er seine erste
Komposition,  den
„Psalm 150“ und „Ouverture mit Chor“ für Orchester Soli und Chor mit
obligatem Klavierpart für den Dirigenten Schumann. Sein zweites kreatives
Betätigungsfeld ist die Literatur. Durch die Buchhandlung seines Vaters
erhält er sogar einfacher Zugang zu den neuesten Werken der Textdichter,
als zu den neuen Musikkompositionen. Schumann verfaßt Gedichte, Reden
und Aufsätze. Begeistert liest er seinen Kollegen u.a. Goethe, Schiller,
Hölderlin, Byron, Shakespeare und später Jean Paul vor. Schumann
ist 14 Jahre alt als seine ältere Schwester Selbstmord begeht. Als
16-jähriger verliert er seinen Vater,
den
„Psalm 150“ und „Ouverture mit Chor“ für Orchester Soli und Chor mit
obligatem Klavierpart für den Dirigenten Schumann. Sein zweites kreatives
Betätigungsfeld ist die Literatur. Durch die Buchhandlung seines Vaters
erhält er sogar einfacher Zugang zu den neuesten Werken der Textdichter,
als zu den neuen Musikkompositionen. Schumann verfaßt Gedichte, Reden
und Aufsätze. Begeistert liest er seinen Kollegen u.a. Goethe, Schiller,
Hölderlin, Byron, Shakespeare und später Jean Paul vor. Schumann
ist 14 Jahre alt als seine ältere Schwester Selbstmord begeht. Als
16-jähriger verliert er seinen Vater,  der
Roberts musikalische Neigungen förderte und sich noch kurz vor seinem
Tod für ihn bei Carl Maria v. Weber eingesetzt hat.
der
Roberts musikalische Neigungen förderte und sich noch kurz vor seinem
Tod für ihn bei Carl Maria v. Weber eingesetzt hat.
Schumanns Wesen verändert sich. Er
wirkt auf seine Umgebung schweigsamer und in sich gekehrter. Im Sommer
1827 lernt er Agnes Carus, die mit einem Arzt verheiratet ist, kennen.
Diese musikbegeisterte Frau macht ihn u.a. mit einigen Schubert Liedern
bekannt, die ihn zu ersten eigenen Liedkompositionen und vierhändigen
Polonaisen anregen. Emil Flechsig, ein Jugendfreund erinnert sich später
an diese Zeit: „Für den damals 1828, erst bekannt werdenden Schubert
faßte er eine rasende Vorliebe und schaffte alles an, was von ihm
zu haben war...Als Schubert im nächsten Winter starb, geriet er bei
der ersten Nachricht seines Todes in solche Aufregung, daß ich ihn
die ganze Nacht schluchzen hörte.“

Auf Wunsch seiner Mutter und seines Vormundes
studiert Robert Schumann nach seinem glänzenden Abitur Jura in Leipzig.
Doch dort nimmt er Klavierunterricht bei Friedrich Wieck, musiziert intensiv,
u.a. Schuberts Es-Dur Klaviertrio und komponiert selbst ein schönes
Klavierquartett. Mit 19 Jahren wechselt er nach Heidelberg, und tritt dort
auch als Pianist in Erscheinung. In den Ostertagen erlebt er Paganini in
Frankfurt, der ihn „aufs äußerste zum Fleiß reizte, wenn
er auch einen Mangel an der großen, edlen, priesterlichen Kunstruhe“
feststellte.
In dieser Zeit reift auch der endgültige
Entschluß zur Musik. Die Abegg-Variationen op.1, die Papillons op.2
und die erste Fassung der Toccata op.7 enstehen. Schumann beschränkt
sich bei seinen ersten veröffentlichten Kompositionen aufs Klavier.
Bei Friedrich Wieck nimmt er wieder den Klavierunterricht auf, und beendet
offiziell das Jurastudium mit der Rückkehr nach Leipzig. Daneben erhält
er noch Theorieunterricht beim damaligen Musikdirektor Heinrich Dorn.  Doch
schon bald danach ist er von beiden Lehrern enttäuscht. In seinem
Tagebuch schreibt er über Wieck: „Er ist doch ein böser Mensch;
Allwin (der kleine Sohn Wiecks) hatte nicht ordentlich gespielt...- wie
er ihn auf den Boden warf, bey den Haaren zaußte, selber zitterte
u. schwankte...u. zu allen diesen lächelte Zilia (Clara Wieck, die
pianistisch hochbegabte Tochter aus erster Ehe) u. setzte sich mit einer
Weber’schen Sonate ruhig an’s Clavier. Bin ich unter Menschen?“ Und über
die Musik seines Theorielehrers: „Dorn’sche Musik. Es ist lächerlich,
wenn Hunde Vögel haschen wollen. Einen Hasen schießt ihr todt,
einen Löwen könnt ihr nicht erwürgen.“ An seinen alten Lehrer
in Zwickau richtet er gleichzeitig folgende Zeilen:
Doch
schon bald danach ist er von beiden Lehrern enttäuscht. In seinem
Tagebuch schreibt er über Wieck: „Er ist doch ein böser Mensch;
Allwin (der kleine Sohn Wiecks) hatte nicht ordentlich gespielt...- wie
er ihn auf den Boden warf, bey den Haaren zaußte, selber zitterte
u. schwankte...u. zu allen diesen lächelte Zilia (Clara Wieck, die
pianistisch hochbegabte Tochter aus erster Ehe) u. setzte sich mit einer
Weber’schen Sonate ruhig an’s Clavier. Bin ich unter Menschen?“ Und über
die Musik seines Theorielehrers: „Dorn’sche Musik. Es ist lächerlich,
wenn Hunde Vögel haschen wollen. Einen Hasen schießt ihr todt,
einen Löwen könnt ihr nicht erwürgen.“ An seinen alten Lehrer
in Zwickau richtet er gleichzeitig folgende Zeilen: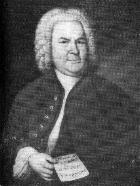 „Bachs Wohltemperiertes Clavier ist meine Grammatik, die beste ohnehin.
Die Fugen selbst hab ich der Reihe nach bis in ihre feinsten Züge
zergliedert; - denn Bach war ein Mann - durch und durch; bei ihm gibt’s
nichts Halbes, Krankes, ist Alles wie für ewige Zeiten geschrieben.“
„Bachs Wohltemperiertes Clavier ist meine Grammatik, die beste ohnehin.
Die Fugen selbst hab ich der Reihe nach bis in ihre feinsten Züge
zergliedert; - denn Bach war ein Mann - durch und durch; bei ihm gibt’s
nichts Halbes, Krankes, ist Alles wie für ewige Zeiten geschrieben.“
Durch übertriebene Fingerübungen
erlahmt zunehmend sein Mittelfinger. Durch dieses Schicksal kann er jedoch
seine Tätigkeit als Komponist intensivieren. Gleichzeitig beginnt
er als Musikschriftsteller zu arbeiten mit der Veröffentlichung seiner
ersten enthusiastischen Besprechung für F. Chopin. Später gründet
er seine eigene Zeitschrift, die NZfM ,
die er zu einem der führenden Organe Deutschlands macht. Er schreibt
seine Artikel aus der Sicht unterschiedlicher Charaktere. Eusebius nennt
er den besonnenen, empfindsamen Charakter, der „so schwärmerisch als
gelassen Blüte nach Blüte auszieht“ , Florestan den kraftvollen,
begeisterungsfähigen, der „alles Zukünftige, Neue, Außerordentliche
schon wie lange vorher geahnt“ und Meister Raro den ausgleichenden, der
„im Verkehr mit Meistern und Meisterwerken und durch Vergleichung zwischen
diesen und den eigenen Leistungen lernt.“ Diese Symbolgestalten und viele
andere faßt er unter dem Begriff „Davidsbündler“ zusammen.
,
die er zu einem der führenden Organe Deutschlands macht. Er schreibt
seine Artikel aus der Sicht unterschiedlicher Charaktere. Eusebius nennt
er den besonnenen, empfindsamen Charakter, der „so schwärmerisch als
gelassen Blüte nach Blüte auszieht“ , Florestan den kraftvollen,
begeisterungsfähigen, der „alles Zukünftige, Neue, Außerordentliche
schon wie lange vorher geahnt“ und Meister Raro den ausgleichenden, der
„im Verkehr mit Meistern und Meisterwerken und durch Vergleichung zwischen
diesen und den eigenen Leistungen lernt.“ Diese Symbolgestalten und viele
andere faßt er unter dem Begriff „Davidsbündler“ zusammen.
Sein Bruder Julius und seine geliebte Schwägerin
Rosalie sterben.. Schumann fällt in ein schweres psychisches Leiden.
Nach langem Schweigen schreibt er seiner Mutter: „Heftiger Blutandrang,
unaussprechliche Angst, Vergehen des Atems, augenblickliche Sinnesohnmacht
wechseln rasch.“ Nach der Genesung knüpft er erste Kontakte zum späteren
Gewandhauskapellmeister Felix Mendelssohn-Bartholdy, dessen Kompositionen
er verehrt.
Schumanns folgende Kompositionen geben
nun erste Hinweise auf Clara Wieck ( Impromtus op.5 ). Henriette Voigt,
die er durch seinen früh verstorbenen Freund und Pianisten Schuncke
kennengelernt hat, und in deren Haus viel musiziert wird, macht ihn mit
Ernestine v. Fricken, einer Schülerin von Friedrich Wieck bekannt.
Schumann verliebt sich in dieses Mädchen. In Briefen an Henriette
Voigt sind bald Zweifel an dieser Beziehung herauszulesen, obwohl Friedrich
Wieck diesen „Sommerroman“ unterstützt, um von Clara abzulenken. Später
steht Ernestine auf der Seite des jungen Paares Clara und Robert im Kampf
gegen Wieck. Zwei gewichtige Werke vollendet Schumann in diesem Zusammenhang,
den Carnaval op.9 und die Sinfonischen Etüden op.13.
 1835,
Schumann ist 25 Jahre alt, fühlt er sich immer unwiderstehlicher von
Clara angezogen. Friedrich Wieck möchte seine Tochter nicht an Schumann
verlieren. Sie soll reisende Virtuosin bleiben mit ihrem Vater als Manager.
Bald kommt es zum offenen Bruch mit Schumann. Er verbietet ihm jeglichen
Umgang mit Clara, nicht einmal Briefe sind erlaubt. Musik wird zum Kommunikationsmittel.
Zusätzlich belastend für Schumann in dieser schweren Zeit ist
der Tod seiner Mutter.
1835,
Schumann ist 25 Jahre alt, fühlt er sich immer unwiderstehlicher von
Clara angezogen. Friedrich Wieck möchte seine Tochter nicht an Schumann
verlieren. Sie soll reisende Virtuosin bleiben mit ihrem Vater als Manager.
Bald kommt es zum offenen Bruch mit Schumann. Er verbietet ihm jeglichen
Umgang mit Clara, nicht einmal Briefe sind erlaubt. Musik wird zum Kommunikationsmittel.
Zusätzlich belastend für Schumann in dieser schweren Zeit ist
der Tod seiner Mutter.
 Er
beendet die drei Sonaten. Die erste Sonate op.11 in fis-Moll widmet er
Clara, die nach dem ersten Durchspielen begeistert reagiert. Franz Liszt
hält dieses Werk für das beste dieser Gattung seit Beethoven.
Dagegen fällt der Entwurf zur Phantasie op.17 in die Zeit der völligen
Trennung von Clara. In den Davidsbündlertänzen op.6 beantwortet
Schumann das musikalische Motto, die von Clara Wieck komponierte Mazurka
op.6/5 mit einer Fortführung ihres Motivs. Zur gleichen Zeit entstehen
auch die Phantasiestücke op.12, die Schumann der Pianistin Robena
Laidlaw, die im Juli 1837 in Leipzig ein Konzert gibt, widmet. Sie hat
sich neben Franz Liszt, Clara Wieck und Adolf Henselt sehr für Schumanns
Werk eingesetzt.
Er
beendet die drei Sonaten. Die erste Sonate op.11 in fis-Moll widmet er
Clara, die nach dem ersten Durchspielen begeistert reagiert. Franz Liszt
hält dieses Werk für das beste dieser Gattung seit Beethoven.
Dagegen fällt der Entwurf zur Phantasie op.17 in die Zeit der völligen
Trennung von Clara. In den Davidsbündlertänzen op.6 beantwortet
Schumann das musikalische Motto, die von Clara Wieck komponierte Mazurka
op.6/5 mit einer Fortführung ihres Motivs. Zur gleichen Zeit entstehen
auch die Phantasiestücke op.12, die Schumann der Pianistin Robena
Laidlaw, die im Juli 1837 in Leipzig ein Konzert gibt, widmet. Sie hat
sich neben Franz Liszt, Clara Wieck und Adolf Henselt sehr für Schumanns
Werk eingesetzt.
Im August desselben Jahres spielt Clara
nach längerer Zeit wieder in Leipzig, u.a. auch aus den Sinfonischen
Etüden op.13, für Robert Schumann nach langer Zeit der Enttäuschung
ein wichtiges Zeichen. Am gleichen Tag schreibt er: „...Schreiben Sie nur
ein einfaches Ja.“ Zwei Tage später erwidert Clara: „...sollte nicht
ein Herz so voll unaussprechlicher Liebe wie das meine, dies kleine Wörtchen
von ganzer Seele aussprechen? ich tue es und mein Innerstes flüstert
es Ihnen ewig zu...“ Doch der Vater lehnt ab, und versucht Schumann loszuwerden.
Schumann gibt dieses Ja neue Energien.
Die Veröffentlichung seiner Werke
betreibt er oft auf eigene Kosten. Die Zeitschrift erfordert auch viel
Arbeit. Neben einer Vielzahl von Besprechungen schreibt er in seiner zehnjährigen
Tätigkeit ca. 3000 Geschäftsbriefe. „...mein Weg ist ein ziemlich
einsamer, ich weiß es, auf dem kein Hurrah einer großen Menge
zur Arbeit anfeuert, auf dem mich nur meine großen Vorbilder Bach
und Beethoven aus der Ferne anblicken und es an Trostworten, an stärkender
Gabe nicht fehlen lassen.“ schreibt er über seine Lage im Februar
1838. Clara reist mit ihrem Vater nach Wien und hat dort großen Erfolg,
allerdings mit den damals üblichen Bravourstücken. Anfang 1838
entstehen die Kinderszenen op.15, die bald Verbreitung finden. Die „Träumerei“
aus diesem Zyklus mit insgesamt 13 Stücken ist wohl auch heute noch
sein bekanntestes Stück. Als Gegenstück zu den Kinderszenen enstehen
die Kreisleriana op.16, in denen eine „recht ordentlich wilde Liebe liegt“.
Der dritte gewichtige Werkzyklus des Jahres 1838, der ursprünglich
mit den Kinderszenen kombiniert werden sollte, sind die Novelletten op.21.
Im Herbst 1838 reist er nach Wien. Vergeblich
bemüht er sich während des halbjährigen Aufenthalts dort
Fuß zu fassen. Das wichtigste Erlebnis ist für ihn die Entdeckung
der C-Dur Sinfonie Schuberts, die er sofort Mendelssohn zur Uraufführung
nach Leipzig schickt. Er hält sie für das Größte,
was je nach Beethoven geschrieben wurde. „Das Clavier möchte ich oft
zerdrücken und es wird mir zu eng zu meinem Gedanken“ schreibt Schumann.
Nach einigen Quartett- und Klavierkonzertversuchen schreibt er schließlich
die letzten Werke der sogenannten Klavierperiode, Arabeske op.18, Blumenstück
op.19, Humoreske op.20, Faschingsschwank aus Wien op.26, Nachtstücke
op.23, Romanzen op28 und die Klavierstücke op.32.
 Clara
ist zu Beginn des Jahres 1839 ohne Begleitung ihres Vaters nach Paris gereist.
Sie beschließen nun, gerichtlich gegen den Vater vorzugehen, um die
Heirat ohne Einwilligung des Vaters zu ermöglichen. Marianne Bargiel,
Claras von Wieck geschiedene Mutter, unterstützt das Paar von Berlin
aus. Der Schlichtungsversuch verläuft ergebnislos. Die von Wieck erlittenen
Kränkungen, Schmähungen vor Gericht, und durch ganz Deutschland
verbreiteten Verleumdungen, lösen bei Schumann wieder eine gefährliche
gesundheitliche Krise aus . Für einige Zeit ist Schumann kaum fähig
zu komponieren. Auf Vermittlung eines Freundes erhält er die Ehrendoktorwürde
der Universität Jena, um damit seinen Stand gegen Wieck vor Gericht
zu verbessern. Nach mehreren Verfahren erlangt er schließlich die
gerichtliche Zustimmung zur Heirat mit Clara im August 1840. Wieck wird
zu 18 Tagen Gefängnis wegen Verleumdung verurteilt. Am 12.September,
am Vorabend zu Claras 21.Geburtstag findet die Trauung in der Dorfkirche
von Schönefeld in Leipzig statt. Als Hochzeitsgabe für Clara
entsteht der Liederzyklus „Myrthen“.
Clara
ist zu Beginn des Jahres 1839 ohne Begleitung ihres Vaters nach Paris gereist.
Sie beschließen nun, gerichtlich gegen den Vater vorzugehen, um die
Heirat ohne Einwilligung des Vaters zu ermöglichen. Marianne Bargiel,
Claras von Wieck geschiedene Mutter, unterstützt das Paar von Berlin
aus. Der Schlichtungsversuch verläuft ergebnislos. Die von Wieck erlittenen
Kränkungen, Schmähungen vor Gericht, und durch ganz Deutschland
verbreiteten Verleumdungen, lösen bei Schumann wieder eine gefährliche
gesundheitliche Krise aus . Für einige Zeit ist Schumann kaum fähig
zu komponieren. Auf Vermittlung eines Freundes erhält er die Ehrendoktorwürde
der Universität Jena, um damit seinen Stand gegen Wieck vor Gericht
zu verbessern. Nach mehreren Verfahren erlangt er schließlich die
gerichtliche Zustimmung zur Heirat mit Clara im August 1840. Wieck wird
zu 18 Tagen Gefängnis wegen Verleumdung verurteilt. Am 12.September,
am Vorabend zu Claras 21.Geburtstag findet die Trauung in der Dorfkirche
von Schönefeld in Leipzig statt. Als Hochzeitsgabe für Clara
entsteht der Liederzyklus „Myrthen“.
 Am
8. Juni 1810 wird Robert Schumann als jüngstes von fünf Geschwistern
in Zwickau geboren. Sein Vater ist Buchhändler, Verleger und Buchautor.
Mit sechs oder sieben Jahren erhält er seinen ersten Klavierunterricht
beim Stadtorganisten Kuntsch, dem er zeitlebens freundschaftlich verbunden
bleibt. Schon früh organisierte er eigene Aufführungen mit Instrumentalisten,
die gerade zur Verfügung standen, dirigierte und ergänzte die
fehlenden Stimmen am Klavier. Mit zwölf Jahren schreibt er seine erste
Komposition,
Am
8. Juni 1810 wird Robert Schumann als jüngstes von fünf Geschwistern
in Zwickau geboren. Sein Vater ist Buchhändler, Verleger und Buchautor.
Mit sechs oder sieben Jahren erhält er seinen ersten Klavierunterricht
beim Stadtorganisten Kuntsch, dem er zeitlebens freundschaftlich verbunden
bleibt. Schon früh organisierte er eigene Aufführungen mit Instrumentalisten,
die gerade zur Verfügung standen, dirigierte und ergänzte die
fehlenden Stimmen am Klavier. Mit zwölf Jahren schreibt er seine erste
Komposition,  den
„Psalm 150“ und „Ouverture mit Chor“ für Orchester Soli und Chor mit
obligatem Klavierpart für den Dirigenten Schumann. Sein zweites kreatives
Betätigungsfeld ist die Literatur. Durch die Buchhandlung seines Vaters
erhält er sogar einfacher Zugang zu den neuesten Werken der Textdichter,
als zu den neuen Musikkompositionen. Schumann verfaßt Gedichte, Reden
und Aufsätze. Begeistert liest er seinen Kollegen u.a. Goethe, Schiller,
Hölderlin, Byron, Shakespeare und später Jean Paul vor. Schumann
ist 14 Jahre alt als seine ältere Schwester Selbstmord begeht. Als
16-jähriger verliert er seinen Vater,
den
„Psalm 150“ und „Ouverture mit Chor“ für Orchester Soli und Chor mit
obligatem Klavierpart für den Dirigenten Schumann. Sein zweites kreatives
Betätigungsfeld ist die Literatur. Durch die Buchhandlung seines Vaters
erhält er sogar einfacher Zugang zu den neuesten Werken der Textdichter,
als zu den neuen Musikkompositionen. Schumann verfaßt Gedichte, Reden
und Aufsätze. Begeistert liest er seinen Kollegen u.a. Goethe, Schiller,
Hölderlin, Byron, Shakespeare und später Jean Paul vor. Schumann
ist 14 Jahre alt als seine ältere Schwester Selbstmord begeht. Als
16-jähriger verliert er seinen Vater,  der
Roberts musikalische Neigungen förderte und sich noch kurz vor seinem
Tod für ihn bei Carl Maria v. Weber eingesetzt hat.
der
Roberts musikalische Neigungen förderte und sich noch kurz vor seinem
Tod für ihn bei Carl Maria v. Weber eingesetzt hat.

 Doch
schon bald danach ist er von beiden Lehrern enttäuscht. In seinem
Tagebuch schreibt er über Wieck: „Er ist doch ein böser Mensch;
Allwin (der kleine Sohn Wiecks) hatte nicht ordentlich gespielt...- wie
er ihn auf den Boden warf, bey den Haaren zaußte, selber zitterte
u. schwankte...u. zu allen diesen lächelte Zilia (Clara Wieck, die
pianistisch hochbegabte Tochter aus erster Ehe) u. setzte sich mit einer
Weber’schen Sonate ruhig an’s Clavier. Bin ich unter Menschen?“ Und über
die Musik seines Theorielehrers: „Dorn’sche Musik. Es ist lächerlich,
wenn Hunde Vögel haschen wollen. Einen Hasen schießt ihr todt,
einen Löwen könnt ihr nicht erwürgen.“ An seinen alten Lehrer
in Zwickau richtet er gleichzeitig folgende Zeilen:
Doch
schon bald danach ist er von beiden Lehrern enttäuscht. In seinem
Tagebuch schreibt er über Wieck: „Er ist doch ein böser Mensch;
Allwin (der kleine Sohn Wiecks) hatte nicht ordentlich gespielt...- wie
er ihn auf den Boden warf, bey den Haaren zaußte, selber zitterte
u. schwankte...u. zu allen diesen lächelte Zilia (Clara Wieck, die
pianistisch hochbegabte Tochter aus erster Ehe) u. setzte sich mit einer
Weber’schen Sonate ruhig an’s Clavier. Bin ich unter Menschen?“ Und über
die Musik seines Theorielehrers: „Dorn’sche Musik. Es ist lächerlich,
wenn Hunde Vögel haschen wollen. Einen Hasen schießt ihr todt,
einen Löwen könnt ihr nicht erwürgen.“ An seinen alten Lehrer
in Zwickau richtet er gleichzeitig folgende Zeilen: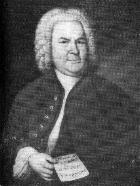 „Bachs Wohltemperiertes Clavier ist meine Grammatik, die beste ohnehin.
Die Fugen selbst hab ich der Reihe nach bis in ihre feinsten Züge
zergliedert; - denn Bach war ein Mann - durch und durch; bei ihm gibt’s
nichts Halbes, Krankes, ist Alles wie für ewige Zeiten geschrieben.“
„Bachs Wohltemperiertes Clavier ist meine Grammatik, die beste ohnehin.
Die Fugen selbst hab ich der Reihe nach bis in ihre feinsten Züge
zergliedert; - denn Bach war ein Mann - durch und durch; bei ihm gibt’s
nichts Halbes, Krankes, ist Alles wie für ewige Zeiten geschrieben.“
 ,
die er zu einem der führenden Organe Deutschlands macht. Er schreibt
seine Artikel aus der Sicht unterschiedlicher Charaktere. Eusebius nennt
er den besonnenen, empfindsamen Charakter, der „so schwärmerisch als
gelassen Blüte nach Blüte auszieht“ , Florestan den kraftvollen,
begeisterungsfähigen, der „alles Zukünftige, Neue, Außerordentliche
schon wie lange vorher geahnt“ und Meister Raro den ausgleichenden, der
„im Verkehr mit Meistern und Meisterwerken und durch Vergleichung zwischen
diesen und den eigenen Leistungen lernt.“ Diese Symbolgestalten und viele
andere faßt er unter dem Begriff „Davidsbündler“ zusammen.
,
die er zu einem der führenden Organe Deutschlands macht. Er schreibt
seine Artikel aus der Sicht unterschiedlicher Charaktere. Eusebius nennt
er den besonnenen, empfindsamen Charakter, der „so schwärmerisch als
gelassen Blüte nach Blüte auszieht“ , Florestan den kraftvollen,
begeisterungsfähigen, der „alles Zukünftige, Neue, Außerordentliche
schon wie lange vorher geahnt“ und Meister Raro den ausgleichenden, der
„im Verkehr mit Meistern und Meisterwerken und durch Vergleichung zwischen
diesen und den eigenen Leistungen lernt.“ Diese Symbolgestalten und viele
andere faßt er unter dem Begriff „Davidsbündler“ zusammen.
 1835,
Schumann ist 25 Jahre alt, fühlt er sich immer unwiderstehlicher von
Clara angezogen. Friedrich Wieck möchte seine Tochter nicht an Schumann
verlieren. Sie soll reisende Virtuosin bleiben mit ihrem Vater als Manager.
Bald kommt es zum offenen Bruch mit Schumann. Er verbietet ihm jeglichen
Umgang mit Clara, nicht einmal Briefe sind erlaubt. Musik wird zum Kommunikationsmittel.
Zusätzlich belastend für Schumann in dieser schweren Zeit ist
der Tod seiner Mutter.
1835,
Schumann ist 25 Jahre alt, fühlt er sich immer unwiderstehlicher von
Clara angezogen. Friedrich Wieck möchte seine Tochter nicht an Schumann
verlieren. Sie soll reisende Virtuosin bleiben mit ihrem Vater als Manager.
Bald kommt es zum offenen Bruch mit Schumann. Er verbietet ihm jeglichen
Umgang mit Clara, nicht einmal Briefe sind erlaubt. Musik wird zum Kommunikationsmittel.
Zusätzlich belastend für Schumann in dieser schweren Zeit ist
der Tod seiner Mutter.
 Er
beendet die drei Sonaten. Die erste Sonate op.11 in fis-Moll widmet er
Clara, die nach dem ersten Durchspielen begeistert reagiert. Franz Liszt
hält dieses Werk für das beste dieser Gattung seit Beethoven.
Dagegen fällt der Entwurf zur Phantasie op.17 in die Zeit der völligen
Trennung von Clara. In den Davidsbündlertänzen op.6 beantwortet
Schumann das musikalische Motto, die von Clara Wieck komponierte Mazurka
op.6/5 mit einer Fortführung ihres Motivs. Zur gleichen Zeit entstehen
auch die Phantasiestücke op.12, die Schumann der Pianistin Robena
Laidlaw, die im Juli 1837 in Leipzig ein Konzert gibt, widmet. Sie hat
sich neben Franz Liszt, Clara Wieck und Adolf Henselt sehr für Schumanns
Werk eingesetzt.
Er
beendet die drei Sonaten. Die erste Sonate op.11 in fis-Moll widmet er
Clara, die nach dem ersten Durchspielen begeistert reagiert. Franz Liszt
hält dieses Werk für das beste dieser Gattung seit Beethoven.
Dagegen fällt der Entwurf zur Phantasie op.17 in die Zeit der völligen
Trennung von Clara. In den Davidsbündlertänzen op.6 beantwortet
Schumann das musikalische Motto, die von Clara Wieck komponierte Mazurka
op.6/5 mit einer Fortführung ihres Motivs. Zur gleichen Zeit entstehen
auch die Phantasiestücke op.12, die Schumann der Pianistin Robena
Laidlaw, die im Juli 1837 in Leipzig ein Konzert gibt, widmet. Sie hat
sich neben Franz Liszt, Clara Wieck und Adolf Henselt sehr für Schumanns
Werk eingesetzt.

 Clara
ist zu Beginn des Jahres 1839 ohne Begleitung ihres Vaters nach Paris gereist.
Sie beschließen nun, gerichtlich gegen den Vater vorzugehen, um die
Heirat ohne Einwilligung des Vaters zu ermöglichen. Marianne Bargiel,
Claras von Wieck geschiedene Mutter, unterstützt das Paar von Berlin
aus. Der Schlichtungsversuch verläuft ergebnislos. Die von Wieck erlittenen
Kränkungen, Schmähungen vor Gericht, und durch ganz Deutschland
verbreiteten Verleumdungen, lösen bei Schumann wieder eine gefährliche
gesundheitliche Krise aus . Für einige Zeit ist Schumann kaum fähig
zu komponieren. Auf Vermittlung eines Freundes erhält er die Ehrendoktorwürde
der Universität Jena, um damit seinen Stand gegen Wieck vor Gericht
zu verbessern. Nach mehreren Verfahren erlangt er schließlich die
gerichtliche Zustimmung zur Heirat mit Clara im August 1840. Wieck wird
zu 18 Tagen Gefängnis wegen Verleumdung verurteilt. Am 12.September,
am Vorabend zu Claras 21.Geburtstag findet die Trauung in der Dorfkirche
von Schönefeld in Leipzig statt. Als Hochzeitsgabe für Clara
entsteht der Liederzyklus „Myrthen“.
Clara
ist zu Beginn des Jahres 1839 ohne Begleitung ihres Vaters nach Paris gereist.
Sie beschließen nun, gerichtlich gegen den Vater vorzugehen, um die
Heirat ohne Einwilligung des Vaters zu ermöglichen. Marianne Bargiel,
Claras von Wieck geschiedene Mutter, unterstützt das Paar von Berlin
aus. Der Schlichtungsversuch verläuft ergebnislos. Die von Wieck erlittenen
Kränkungen, Schmähungen vor Gericht, und durch ganz Deutschland
verbreiteten Verleumdungen, lösen bei Schumann wieder eine gefährliche
gesundheitliche Krise aus . Für einige Zeit ist Schumann kaum fähig
zu komponieren. Auf Vermittlung eines Freundes erhält er die Ehrendoktorwürde
der Universität Jena, um damit seinen Stand gegen Wieck vor Gericht
zu verbessern. Nach mehreren Verfahren erlangt er schließlich die
gerichtliche Zustimmung zur Heirat mit Clara im August 1840. Wieck wird
zu 18 Tagen Gefängnis wegen Verleumdung verurteilt. Am 12.September,
am Vorabend zu Claras 21.Geburtstag findet die Trauung in der Dorfkirche
von Schönefeld in Leipzig statt. Als Hochzeitsgabe für Clara
entsteht der Liederzyklus „Myrthen“.